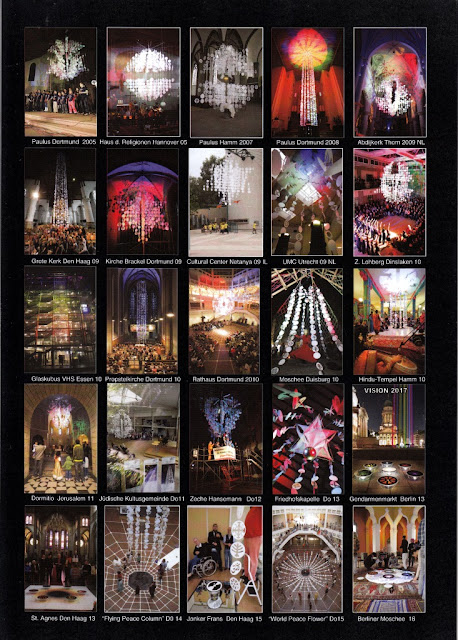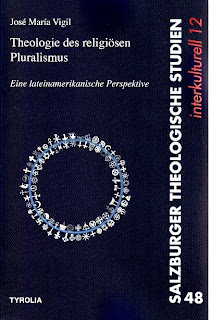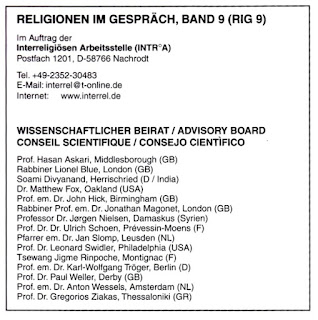![]() |
Nikolaus von Kues.
Zeitgenössisches Stifterbild
vom Hochaltar der Kapelle
des St.-Nikolaus-Hospitals,
Bernkastel-Kues(Wikipedia)
|
Zeittafel
1401 Nikolaus von Kues (Krebs, Cryfftz, Cusanus)
wird in Kues an der Mosel geboren.
1416 Theologisches und juristische Studium
an der Universität Heidelberg.
1423 Studium des Kirchenrechts an der
Universität Padua, Abschluss: doctor decretorum.
1425 Studium in Köln bei dem Albertisten
Heymericus de Campo.
Sekretär des Trierer Erzbischofs.
1428 Reise nach Paris. Studium der Werke
Ramon Lulls. Die Universität trägt ihm den
Lehrstuhl für kanonisches Recht an, er lehnt ab
(wie später 1435 auch).
1430 Er wird Kanzler des Trierer
Bischofskandidaten Ulrich von Manderscheid.
1431 Eröffnung des Konzils von Basel.
Eugen IV. (gest. 1447) wird Papst.
1432 Auf dem Konzil von Basel vertritt
Cusanus die Ansprüche auf den vakanten
Trierer Bischofsstuhl, den Ulrich von Manderscheid
besetzen möchte.
1433-34 De concordantia catholica entsteht.
Eugen IV. krönt König Sigismund in Rom zum deutschen Kaiser.
1436 Cusanus geht mit einer Konzilsminderheit auf die päpstliche Seite über.
1438 Als Gesandter von Papst Eugen IV. tritt er auf deutschen Reichstagen
für die Sache des Papstes ein.
1439 Das Konzil zu Basel erklärt Papst Eugen IV. für abgesetzt; es spricht sich
für die Oberhoheit des Konzils über den Papst aus.
Das Konzil von Florenz wird eröffnet.
1440 De docta ignorantia. Friedrich III. von Österreich zum Kaiser gewählt.
1442-43 Der Heidelberger Theologe Johannes Wenck von Herrenberg verfasst
gegen Cusanus sein Werk De ignota litteratura.
1445 Cusanus schreibt De filiatione dei und De dato patris luminum.
1447 Tomaso Parentucelli (1455 gest.) wird als Nikolaus V. zum Papst gewählt.
1448 Ernennung des Cusanus zum Kardinal in San Pietro in Vincoli.
Kaiser Friedrich III. schließt mit der Kurie das Konkordat von Wien ab.
1449 In Verteidigung gegen die Angriffe von Johannes Wenck erscheint die
Apologia doctae ignorantiae.
1450 Cusanus wird zum Kardinal in Rom erhoben, wird Bischof von Brixen und reist
als päpstlicher Legat durch Deutschland.
1451 Cusanus nimmt sein Bischofsamt in Brixen auf. Bernhard von Waging,
Abt des Klosters Tegernsee, würdigt die docta ignorantiain seiner Schrift
Laudatorium doctae ignorantiae. Dies löst einen theologischen Streit aus.
1453 Cusanus verfasst De pace fidei.
1455 Calixt III. (gest. 1458) wird Papst.
1457 Cusanus wird zum Kurienkardinal und Generalvikar in Rom ernannt.
De beryllo entsteht.
1458 E. S. Piccolomini (gest. 1464) gelangt als Pius II. auf den Stuhl Petri.
1460 Cusanus versucht nach Brixen zurückzukehren, wird aber durch
Herzog Sigismund vertrieben. Die berühmte dialogoffene
Auslegung des Koran entsteht: Cribratio Alkorani.
1462 Cusanus schreibt den Traktat Directio speculantis seu non aliud.
1463 Er scheitert bei der Kirchenreform in Orvieto. Die Abhandungen:
De ludo globi und De venatione sapientiae werden abgeschlossen.
1464 Vollendung von Compendium und De apice theoria.
Am 11. August stirbt Cusanus in Todi (Umbrien).
Nach: Norbert Winkler:
Nikolaus von Kues zur Einführung.
Hamburg: Junius 2001, S. 229-230
Im Folgenden sind einige Zitate aus den Schriften des Nikolaus von Kues ausgewählt, die seine philosophischen und theologischen Grundlagen näher beleuchten und zugleich die Offenheit seines dialogischen Denkens zeigen. Die zitierten Bücher sind leider nur noch antiquarisch erhältlich, allerdings gibt es teilweise Neuausgaben.
Weitere Informationen zu Leben und Werk, s.u. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Geheimnis Gottes und belehrte Unwissenheit
------------------------------------------------------------------------------------------
ZITATE AUS SEINEN WERKEN
Docta ignorantia (belehrte Unwissenheit)
und coincidentia oppositorum (Zusammenfall der Gegensätze)
Das „Nichtandere" als Seins- und Erkenntnisprinzip
Ferdinand:Dass du im Begriff des „Nichtanderen" das Seins- und Erkenntnisprinzip zu fassen suchst, ist klar, aber du musst mir das schon noch deutlicher aufzeigen, wenn ich es ganz verstehen soll.
Nikolaus:Nach Aussage der Theologen zeigt sich uns Gottes Wesen ziemlich klar im Bilde des Lichtes, da wir ja mit Hilfe sinnenfälliger Bilder uns zur Erkenntnis unanschaulicher Gegenstände erheben. In der Tat ist das reine Licht, das Gott ist, vor allem anderen Lichte, wie wir dieses auch benennen mögen, und vor allem anderen schlechthin. Was aber vor dem Anderen sich zeigt, ist nicht das Andere. Da nun jenes Licht das „Nichtandere" selbst ist und nicht irgendein benennbares Licht, so findet es seinen Widerschein im wahrnehmbaren Lichte. Man begreift jedoch irgendwie, dass das Verhältnis des wahrnehmbaren Lichtes zur sinnlichen Wahrnehmung dem gleich ist, welches das Licht des „Nichtanderen" mit allem verbindet, was der Geist zu erfassen vermag. Erfahrungsgemäß sieht das sinnliche Auge nichts ohne das sinnliche Licht, und die sichtbare Farbe ist, wie der Regenbogen zeigt, nur die Begrenzung oder Bestimmung des sinnlichen Lichtes'. So ist das sinnlich wahrnehmbare Licht das Seins- und Erkenntnisprinzip für die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung. Daraus leiten wir die Behauptung ab, dass das Seinsprinzip zugleich auch das Erkenntnisprinzip ist'.
Ferdinand: Eine klare und willkommene Anleitung! Die gleichen Verhältnisse liegen beim sinnlichen Hören vor. Der Ton ist Seins- und Erkenntnisprinzip des Hörbaren. Gott, den wir mit dem „Nichtanderen" bezeichnen, ist demnach für alles Seins- und Erkenntnisprinzip. Denkt man ihn, so bleibt nichts, weder im Bereich der Gegenstände, noch in dem des Erkennens. Wie nach dem Wegfall des Lichts weder ein Sein noch ein Sehen des Regenbogens oder des Sichtbaren möglich ist, und wie nach dem Wegfall des Tons es weder ein Sein noch ein Hören eines Hörbaren gibt, so bleibt mit dem Wegfall des „Nichtanderen" weder ein Sein noch ein Erkennen überhaupt. Diese Sachverhalte halte ich unverrückbar fest.
Nikolaus:Mit Recht hältst du sie fest, doch achte bitte auf folgendes: Wenn du etwas siehst, etwa einen Stein, so ist dein Sehen allein durch die Vermittlung des Lichtes möglich, auch wenn du nicht darauf achtest. Ebenso dankst du dein Hören der Vermittlung des Tones, mag dir auch dieser Sachverhalt nicht zum Bewusstsein kommen. Im voraus bietet sich also das Seins- und Erkenntnisprinzip an als notwendige Vorbedingung, ohne die dein Streben nach Sehen oder Hören vergeblich wäre. Da im übrigen deine Absicht auf etwas anderes geht, das du zu sehen oder zu hören begehrst, so hältst du dich nicht bei der Betrachtung des Ursprungs auf, obgleich es Ursprung, Mitte und Ziel des Gesuchten ist.
In der gleichen Weise achte auf das „Nichtandere". Da alles, was nur immer ist, nichts anderes ist als es selbst, so hat es diese Beschaffenheit nicht anderswoher; es hat sie folglich von dem „Nichtanderen". Allein dem „Nichtanderen" verdankt das Seiende sein Sein sowie die Erkennbarkeit seines Seins; es ist seine Ursache, sein völlig zureichender Grund oder seine Wesensbestimmung: es bietet sich vorher dar, ist es doch Ursprung, Mitte und Ziel dessen, was der Geist eigentlich sucht.
Vom Nichtanderen (Hg. Paul Wilpert). Hamburg: F. Meiner 1987, 3. Aufl., S. 7-9
Gott: Das Unerfassliche erfassen?
Wie könnte das Verlangen verlangen, nicht zu sein? Ob der Wille verlangt, zu sein oder nicht zu sein, das Verlangen selbst vermag nicht zu ruhen, sondern geht weiter ins Unendliche. Du lässt Dich herab Herr, um begriffen zu werden, und bleibst doch zählbar und unendlich; bliebest Du nicht unendlich, so wärest Du nicht das Ziel der Sehnsucht. Du bist ja unendlich, um das Ziel jeder Sehnsucht zu sein. vernunfthafte Sehnen bezieht sich ja nicht auf etwas, das größer oder begehrenswerter zu sein vermag. Alles aber, das diesseits des Unendlichen liegt, vermag größer zu sein. Das Ziel der Sehnsucht ist also unendlich.
Du bist, o Gott, die Unendlichkeit, die allein ich in jeder Sehnsucht ersehne. Dem Wissen um diese Unendlichkeit kann ich mich nicht mehr nähern als soweit, dass ich weiß, sie ist unendlich. Je besser ich also erfasse, mein Gott, dass Du unerfasslich bist, desto besser erreiche ich Dich, weil ich dem Ziel meiner Sehnsucht näher komme.
Was immer mir entgegentritt, das Dich als erfassbar zu beweisen bemüht ist, verwerfe ich, da es mich auf Irrwege führt. Meine Sehnsucht, in der Du widerstrahlst, führt mich zu Dir, weil sie das Endliche und Begrenzte verwirft. In ihm vermag sie keine Ruhe zu finden, da sie von Dir zu Dir geführt wird. Du aber bist der Ursprung ohne Ursprung und das Ende ohne Ende. Die Sehnsucht wird also vom ewigen Ursprung, von dem sie hat, dass sie Sehnsucht ist, zu dem Ende ohne Ende geführt. Und dieses ist unendlich. Dass ich geringer Mensch nicht zufrieden wäre in Dir, wenn ich wüsste, dass ich Dich erfassen kann, kommt daher, dass ich von Dir in das Unfassbare und Unendliche geführt werde.
Ich sehe Dich, mein Gott, in einer Art geistiger Entrückung; denn wenn schon das Auge nicht im Sehen Genüge findet, und das Ohr nicht im Hören, so noch weniger die Vernunft in dem, was sie einsieht. Denn nicht das, was die Vernunft einsieht, sättigt sie oder ist ihr Ziel. Aber auch nicht das, was sie durchaus nicht versteht, vermag sie zu sättigen, sondern vielmehr das, was sie durch Nicht-Einsehen erkennt. Weder das Einsichtige, das sie erkennt, noch das Einsichtige, das sie gar nicht erkennt, sättigt sie; vielmehr vermag ihr nur dasjenige Einsichtige, das sie als so sehr einsichtig erkennt, dass sie es niemals völlig einsehen kann, Sättigung zu bringen. Wer an unersättlichem Hunger leidet, den vermag weder ein wenig Speise, die er hinunterschlucken kann, noch Speise, die gar nicht zu ihm hingelangt, zu sättigen, sondern allein jene Speise, die zu ihm kommt, und die, auch wenn er ständig von ihr zehrt, doch nie völlig verzehrt werden kann, da sie von solcher Art ist, dass sie sich durch das Verzehrtwerden nicht verringert, weil sie unendlich ist.
Vom Sehen Gottes. Ein Buch mystischer Betrachtung. Zürich / München: Artemis 1987, S. 76-77
Die göttliche Vorsehung und die Vereinigung der Gegensätze
(coincidentia oppositorum)
Um auch an einem Beispiel zu erfahren, bis zu welcher Tiefe der Erkenntnis uns die angestellten Überlegungen zu führen vermögen, wollen wir das Ergebnis unserer Untersuchungen auf die göttliche Vorsehung anwenden. Aus dem früher Gesagten ist bekannt, dass Gott die Einfaltung von allem, auch des Gegensätzlichen, ist. Es kann deshalb nichts seiner Vorsehung entgehen. Wir mögen etwas tun oder das Gegenteil davon oder nichts tun, alles ist in Gottes Vorsehung eingeschlossen. Nichts wird sich deshalb ereignen, es sei denn gemäß der Vorsehung Gottes.
Obwohl also Gott vieles hätte vorsehen können, was er nicht vorsah, noch vorsehen wird, und obwohl er auch vieles vorsah, was er hätte nicht vorsehen können, so lässt sich doch der göttlichen Vorsehung nichts hinzufügen oder wegnehmen. Nehmen wir einen Vergleich. Die menschliche Natur ist einfach und einheitlich. Käme ein Mensch zur Welt, dessen Geburt niemals hätte erwartet werden können, so würde der menschlichen Natur nichts hinzugefügt werden. Ebenso würde ihr nichts entzogen, wenn er nicht geboren würde, wie ihr auch nichts entzogen wird, wenn Menschen sterben, die geboren sind. Der Grund dafür liegt darin, dass die menschliche Natur ebenso die umfasst, die leben, wie die, welche nicht leben und nicht leben werden, obwohl sie leben könnten. In gleicher Weise würde der göttlichen Vorsehung nichts hinzugefügt, selbst wenn etwas geschähe, was nie sich ereignen wird, da sie sowohl das in sich trägt, was geschieht, wie das, was nicht geschieht, aber geschehen könnte. Wie also vieles in der Materie der Möglichkeit nach ist, was niemals geschehen wird, so ist im Gegensatz dazu alles, was nicht geschehen wird, aber geschehen könnte, nicht der Möglichkeit nach, sondern in Wirklichkeit, wenn es in der göttlichen Vorsehung ist. Daraus folgt aber nicht, dass diese Ereignisse wirklich sind. Wie wir also sagen, dass die menschliche Natur unendlich viele Individuen umgreift und umfasst, weil nicht nur die Menschen, die waren, sind oder sein werden, sondern auch die, welche sein können, auch wenn sie niemals sein werden, und wie die menschliche Natur auf diese Weise das Wandelbare in unwandelbarer Weise umfasst wie die unendliche Einheit jedwede Zahl, so umgreift die unendliche göttliche Vorsehung ebenso das, was geschehen wird, wie das, was nicht geschehen wird, aber geschehen könnte, und ebenso das Gegenteil davon, wie die Gattung die konträren Unterschiede umgreift. Und das, was die göttliche Vorsehung weiß, weiß sie nicht in Unterscheidung der Zeit, weil sie das Künftige nicht als künftig, noch das Vergangene als vergangen weiß, sondern in ewiger Weise und damit das Wandelbare in unwandelbarer Weise.
Darum ist sie unausweichlich und unwandelbar, und nichts kann sich ihr entziehen. Darum sagt man auch, dass alles, was auf die göttliche Vorsehung bezogen ist, Notwendigkeit besitzt. Man sagt es mit Recht, denn alles ist in Gott Gott, der die absolute Notwendigkeit ist. Damit ist klar, dass das, was nie geschehen wird, in der angegebenen Weise in der göttlichen Vorsehung ist, auch wenn nicht vorgesehen ist, dass es je geschehen soll. Notwendig aber muss Gott vorgesehen haben, was er vorgesehen hat, da seine Vorsehung notwendig und unwandelbar ist. Freilich konnte er auch das Gegenteil von dem vorsehen, was er vorgesehen hat. Mit der Setzung der Einfaltung ist ja noch nicht das eingefaltete Ding gesetzt, aber mit der Setzung der Ausfaltung ist die Einfaltung gesetzt. Zugestanden ich kann morgen lesen oder nicht lesen, was ich aber auch immer tue, ich entgehe nicht der Vorsehung, die Gegensätzliches umfasst.
Die belehrte Unwissenheit (docta ignorantia),
Buch I (Hg. Paul Wilpert). Hamburg: F. Meiner 1964, S. 89-93
Die negative Theologie (theologia negativa)
Die heilige Unwissenheit hat uns die Unaussprechlichkeit Gottes gelehrt, und zwar wegen seiner unendlichen Erhabenheit über alles, was sich benennen lässt. Weil dies unbedingt wahr ist, sprechen wir richtiger von ihm, wenn wir alles Geschöpfliche abstreifen und verneinen. Der große Dionysius ( = Dionysius Areopagita) wollte ihn darum weder Wahrheit noch Vernunft noch Licht noch irgendetwas von dem genannt wissen, was man aussprechen kann. Seinem Beispiel folgten Rabbi Salomon und alle Weisen. Gemäß dieser negativen Theologie ist er deshalb weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist. Er ist nur der Unendliche. Die Unendlichkeit als solche aber ist weder Zeugen noch Gezeugtwerden noch Hervorgehen. Hilarius von Poitiers hat darum bei der Unterscheidung der Personen die scharfsinnige Wendung gebraucht: „Im Ewigen Unendlichkeit, Idee im Bild, Ausübung in der Gabe.“ Er wollte damit sagen, dass wir zwar in der Ewigkeit nur die Unendlichkeit zu sehen vermögen, die Unendlichkeit aber, die Ewigkeit ist, trotzdem wegen ihrer Negativität nicht als erzeugend aufgefasst werden kann, wohl aber die Ewigkeit, da die Ewigkeit die affirmative Bezeichnung für die Einheit, d. h. die reine Gegenwart ist. Sie ist deshalb Ursprung ohne Ursprung. Idee im Bild bedeutet Prinzip vom Prinzip, Ausübung in der Gabebedeutet Hervorgang aus beiden.
Das alles ist durch die früher angestellten Überlegungen deutlich geworden. Obschon nämlich die Ewigkeit Unendlichkeit ist, so dass die Ewigkeit nicht in größerem Maße Sache des Vaters ist als die Unendlichkeit, so wird doch in der Art der Betrachtung die Ewigkeit dem Vater zugeschrieben und nicht dem Sohn oder dem Heiligen Geist, die Unendlichkeit jedoch nicht einer Person mehr als der anderen. Betrachtet man nämlich die Einheit, so ist die Unendlichkeit Vater; betrachtet man die Gleichheit der Einheit, so ist sie Sohn; betrachtet man die Verbindung, so ist sie Heiliger Geist. Betrachtet man die Unendlichkeit schlechthin, so ist sie weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist. Dabei ist freilich die Unendlichkeit und ebenso die Ewigkeit irgendeine der drei Personen und umgekehrt jede Person Unendlichkeit und Ewigkeit. Für die Betrachtung jedoch gilt das, wie gesagt, nicht. Denn unter dem Gesichtspunkt der Unendlichkeit ist Gott weder Eines noch vieles. Vom Standpunkt der negativen Theologie findet sich in Gott nichts als Unendlichkeit. Ihr zufolge ist er darum weder in dieser noch in der künftigen Welt erkennbar, da jedes Geschöpf, welches das unendliche Licht nicht zu erfassen vermag, ihm gegenüber Finsternis ist. Er ist vielmehr nur sich selbst bekannt.
Daraus erhellt, dass in theologischen Aussagen Verneinungen wahr und positive Aussagen unzureichend sind. Ebenso sind die negativen Aussagen umso wahrer, je mehr sie Unvollkommenheiten vom schlechthin Vollkommenen abwehren, so wie es wahrer ist, dass Gott nicht Stein ist, als dass er nicht Leben oder Vernunft ist, und wahrer, dass er nicht Trunkenheit, als dass er nicht Tugend ist. Bei den bejahenden Aussagen gilt das Umgekehrte, denn die Aussage, die Gott Vernunft und Leben nennt, ist wahrer als die, welche ihn als Erde, Stein oder Körper bezeichnet.
Das alles ist auf Grund der früheren Überlegungen klar. Wir ziehen daraus den Schluss, dass die genaue Wahrheit im Dunkel unserer Unwissenheit in der Weise des Nichterfassens aufleuchtet. Das ist die belehrte Unwissenheit, die wir gesucht haben. Durch sie allein vermögen wir, wie gezeigt, dem größten dreieinigen Gott in seiner unendlichen Güte je nach dem Rang der Wissenschaft von der Unwissenheit nahe zu kommen, um ihn aus all unserer Kraft immerdar dafür zu preisen, dass er uns sich selbst als unfassbar gezeigt hat. Er sei in Ewigkeit hochgebenedeit.
Die belehrte Unwissenheit, Buch I (Hg. Paul Wilpert). Hamburg: F. Meiner 1964, S. 111-113
Der Weg zur Glückseligkeit
PETRUS: Das Hauptanliegen dessen, der dieses Gesetz, den Koran, aufgeschrieben hat, scheint gewesen zu sein, das Volk vom Götzendienst abzubringen. Diesem Ziel dienen Form und Inhalt der Verheißungen. Doch der Verfasser des Korans verurteilt das Evangelium nicht, im Gegenteil, er lobt es und gibt so zu verstehen, dass die Glückseligkeit, die im Evangelium verheißen wird, nicht weniger wert sei als die körperliche. Und die Verständigen und Weisen unter den Moslems wissen das. Avicenna, zum Beispiel, schätzt die geistige Glückseligkeit des Genießens und der Schau Gottes und der Wahrheit unvergleichlich höher ein als die im Gesetz der Araber beschriebene Glückseligkeit. Und so halten es auch die anderen Weisen.
Es wird also nicht schwierig sein, in diesem Punkt alle Glaubensrichtungen zur Übereinstimmung zu bringen. Man muss nur betonen, dass jene Glückseligkeit, die wir meinen, über alles geht, was man schreiben oder sagen kann, weil sie die Erfüllung alles Verlangens ist und bedeutet, dass man das Gute in seiner Quelle und das Leben in Unsterblichkeit erlangt.
Vom Frieden zwischen den Religionen
(Hg. K. Berger / C. Nord). Frankfurt/M. / Leipzig: Insel 2002, S. 123
Weitere Hinweise zu Leben und Werk
- Nikolaus von Kues (Wikipedia)
- Tilman Borsche / Harald Schwaetzer (Hg.):
Können -Spielen - Loben -Cusanus 2014
Texte und Studien zur Europäischen Geistesgeschichte, Reihe B, Bd. 14
Münster: Aschendorff 2016, 544 S. - Walter Andreas Euler: Cusanus - Leben, Persönlichkeit und Werk
(Cusanus-Portal) - Walter Andreas Euler / Tom Kerger (Hg.): Cusanus und der Islam.
Paulinus: Trier 2010, 154 S.
- Elena Filippi:La dimensione estetica del pensiero di Niccolò Cusano in
rapporto al tema dello sguardo.
Per le relazioni tra filosofia e arte agli albori del Rinascimento, 33-51.
Verbum et imago coincidunt.
Il linguaggio come specchio vivo in Cusano, a cura di G. Cuozzo et al.,
Milano: Mimesis 2019 - Ulf Hangert / Wolfgang Port / Karl-Heinz van Lier (Hg.):
Gesellschaftliche Verantwortung für Europa?
V. Kueser Gespräche. Münster. Aschendorff 2018, 67 S. - Davide Monaco:
Nicholas of Cusa: Trinity, Freedom and Dialogue.
Texte und Studien zur Europäischen Geistesgeschichte, Reihe B, Bd. 13
Münster: Aschendorff 2016, 183 S.
Zusammenstellung: Reinhard Kirste
Relpäd/Nikolaus von Kues, ,bearb. 16.03.17 u.ö.
CC